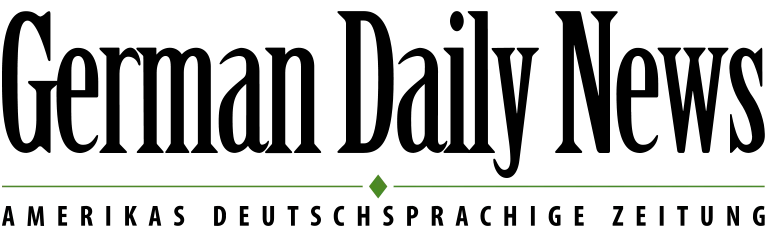Kultur
„Echos aus Eritrea“ am Staatstheater Kassel
Die Geister der Vergangenheit

(Quelle: Sylwester Pawliczek)
Eritrea ist ein Staat im nordöstlichen Afrika, der geprägt von Kolonialherrschaft nach dreißigjährigem Unabhängigkeitskrieg 1993 seine Souveränität erlangen konnte. Jedoch sehen sich seitdem Millionen Menschen zur Flucht aus ihrer Heimat gezwungen. Präsident Isaias Afewerki regiert in einem Ein-Parteien-System, das keine Wahlen kennt. Es existieren weder ein Parlament noch unabhängige Gerichte und die staatliche Wehrpflicht ist de facto zeitlich unbegrenzt und gleicht einer Zwangsarbeit. Laut Amnesty International kommt es regelmäßig zu schwerwiegenden Verletzungen der Menschenrechte. Die politische Lage hat dazu geführt, dass etwa ein Fünftel der Bevölkerung Eritreas außerhalb des Landes ansässig sind. Etwa 1000 von ihnen haben in Kassel eine Heimat gefunden.
Patricia Nickel-Dönicke, die Schauspieldirektorin und Chefdramaturgin am Schauspiel des Staatstheaters, hat sich seit ihrer Zeit in Kassel eingehend mit der Stadtgesellschaft und ihrer sozialen Struktur auseinandergesetzt. Es ist ihr Verdienst, dieser wiederholt eine Stimme zu verleihen und als Stoff in den Spielplan integriert zu haben.
„Echos aus Eritrea“ ist ein Abend, an dem Geschichten erzählt und Erfahrungen aus der eritreischen Community in Kassel geteilt werden. In der live gespielten Musik der Sängerin und Pianistin Romy Camerun finden diese ein Echo.
Zum Einstieg hören die Zuschauer:innen die in mancherlei Hinsicht klischeehafte Geschichte von Johanna, die für ihre Familie einen beschwerlichen, zweistündigen Fußmarsch auf sich nimmt, um 20 Liter Wasser zu beschaffen. Man erfährt zudem, dass zu einer traditionellen Kaffeezeremonie in Eritrea frisch geröstetes Popcorn gereicht wird und dass das landestypische Brot köstlich schmeckt. Das Publikum wird über die Vielschichtigkeit der eritreischen Gesellschaft, die neun Volksgruppen umfasst, informiert aber auch über den oftmals unsicheren Aufenthaltsstatus der in Deutschland lebenden Eritreer. Es hört verstörende Schilderungen über erlebten Alltagsrassismus sowie bedrückende Erinnerungen an Fluchterlebnisse und Inhaftierungen.
Die Suche nach einer neuen Heimat erfolgt stets vor dem Hintergrund aufflackernder Geister der Vergangenheit, denen die Menschen nicht entkommen können.
Die Suche nach einer neuen Heimat erfolgt stets vor dem Hintergrund aufflackernder Geister der Vergangenheit, denen die Menschen nicht entkommen können.
"Echos aus Eritrea" ist kein konventioneller Theaterabend, an dem durch Schauspieler:innen verkörperte Figuren eine fiktive Geschichte erzählen, sondern vielmehr ein Rechercheprojekt. Das Team um Regisseurin Nina Mattenklotz hat individuelle Erfahrungen und Erinnerungen aus der eritreischen Community zusammengetragen, wobei jeder der beteiligten Schauspieler:innen gezielt zu spezifischen Themenschwerpunkten recherchiert hat. Dabei sei man auf eine heterogene Gemeinschaft gestoßen, was sich im Bühnengeschehen jedoch nur begrenzt widerspiegelt.
Es liegt in der Natur der Sache bei einem derartigen Projekt, dass es kaum möglich ist und auch nicht als Ziel angestrebt werden muss, ein vollständiges objektives Bild zu zeichnen. Es ist legitim, sich auf bestimmte Themen zu fokussieren und sich seine Gesprächspartner:innen auszuwählen. Zudem war das Team gezwungen, sich auf die Menschen zu beschränken, die bereit waren und ein Interesse daran hatten, sich aktiv an dem Projekt zu beteiligen. In der eritreischen Community äußerten einige Mitglieder Unzufriedenheit darüber, dass sie sich nicht angemessen repräsentiert fühlten. So kommen junge Menschen, die womöglich in Deutschland geboren wurden, an dem Abend kaum vor. Auch wurde von manchen Seiten bemängelt, dass ein zu negatives Bild von Eritrea gezeichnet werde. Eine Kritik, die gegen Ende des Abends auch auf der Bühne aufgegriffen wird.
Ausstattungsleiterin Sibylle Pfeiffer hat die beteiligten Schauspieler:innen in Alltagskleidung gehüllt und ein Bühnenbild geschaffen, das den Recherchecharakter des Stückes hervorhebt. So wird eine nahbare Atmosphäre geschaffen. Die Akteure, die sich zu Beginn des Abends namentlich vorstellen und nicht in klassische Rollen schlüpfen, trinken auf der Bühne gemeinsam Kaffee, sitzen beisammen oder spielen miteinander Gesellschaftsspiele.
Das Stück endet mit einer unmittelbaren Ansprache an das Publikum. Diese einladende Geste hätte der Auftakt zu einem Nachgespräch sein können. Bereits im Anschluss an die öffentliche Probe in der vergangenen Woche hatte sich gezeigt, dass die Produktion zu Diskussionen und mitunter kontroversem Gedankenaustausch anregt. Es wäre für das Publikum sicherlich ergiebig und dem Anspruch auf Transparenz und Offenheit förderlich, wenn nach der Aufführung Gesprächsrunden ermöglicht würden, in denen sich Zuschauer:innen, Mitglieder der eritreischen Community und Beteiligte des Staatstheaters über das zuvor Erlebte austauschen könnten – vielleicht bei einer Tasse Kaffee mit Popcorn.
Für den Artikel ist der Verfasser verantwortlich, dem auch das Urheberrecht obliegt. Redaktionelle Inhalte von GDN können auf anderen Webseiten zitiert werden, wenn das Zitat maximal 5% des Gesamt-Textes ausmacht, als solches gekennzeichnet ist und die Quelle benannt (verlinkt) wird.